Die Beantwortung Ihrer Frage ist Teil eines Forschungsprojekts zur Verständlichkeit von grammatischen Erklärungen. Wir bitten Sie deshalb darum, im Anschluss an die Lektüre der Antwort die Tools zur Bewertung (Fragebogen, Sternchenfunktion, Antwortoption) zu nutzen.
Sie fragen, in welchen Fällen der Konjunktiv obligatorisch ist und wann auf den Indikativ zurückgegriffen werden kann. Dazu lässt sich generell festhalten, dass der
Indikativ der unmarkierte Modus ist und immer dann zu wählen ist, wenn kein Anlass für die Wahl eines anderen Modus besteht. (Vgl. Dudengrammatik, Randnummer 714) Daher gilt zu klären, in welchen Fällen auf den Konjunktiv zurückgegriffen werden sollte. Die hauptsächlichen Funktionsbereiche des Konjunktivs sind das Ausdrücken von
Irrealität und
Potentialität sowie der
Redewiedergabe. (Vgl. Dudengrammatik, Randnummer 748) Als Faustregeln für die Verwendung des Konjunktivs bzw. Indikativs können die folgenden Überlegungen festgehalten werden:
1.
Wenn das, was der Konjunktiv markieren soll, im Kontext bereits ausreichend gekennzeichnet ist, geht auch Indikativ. Dies ist bspw. der Fall, wenn auf andere Weise kenntlich gemacht wird, dass es sich um eine Redewiedergabe handelt.
2.
Wenn Irrealität bzw. Potentialität ausgedrückt werden soll, empfiehlt sich in der Regel dennoch der Konjunktiv. Insbesondere bei Konditionalsätzen lassen sich durch den Konjunktiv irreale/potentielle Konditionale von realen gut abgrenzen.
3. Auch auf das
Umgebungstempus muss Rücksicht genommen werden, da dies einen Einfluss darauf hat, ob und welcher Konjunktiv zu wählen ist.
Vor diesem Hintergrund werden nun Ihre Beispiele betrachtet, um zu überprüfen, ob der Konjunktiv stehen muss. Dabei werden die einzelnen Beispiele gruppiert, sodass deutlich wird, welche Beispiele ähnlich aufgebaut sind:
1. Konjunktiv bei Sätzen, die mit als ob eingeleitet werden
Bei der Konjunktion
als ob kann der Konjunktiv II vom Sprecher gewählt werden, um eine
irreale Bedeutung zu artikulieren. D.h., durch den Konjunktiv kann gezeigt werden, dass es sich hier um eine
kontrafaktische Aussage handelt. Sie fiel in Ihrem Beispiel also nicht tatsächlich in Ohnmacht, sondern es fühlte sich lediglich so an, als sei dies der Fall. Um diese Kontrafaktizität auszudrücken, eignet sich der Konjunktiv besonders gut. Allerdings ist hier der Indikativ nicht auszuschließen, da durch die Konjunktion
als ob bereits gekennzeichnet wurde, dass es hier um etwas Kontrafaktisches geht. Angewendet auf Ihre Beispiele, sind daher folgende Varianten möglich:
Beispiel
1a) Es fühlte sich an, als ob sie in Ohnmacht fiele.
1b) Es fühlte sich an, als ob sie in Ohnmacht fiel.
2a) Das Eis sah aus, als ob es bereits schmölze.
2b) Das Eis sah aus, als ob es bereits schmilzt.
3a) Es war, als ob diese Sache nie passiert wäre.
3b) Es war, als ob diese Sache nie passiert war.
2. Konjunktiv bei Sätzen mit weiteren Indikatoren für Irrealität
Neben der bisher genannten Möglichkeit anhand der Konjunktion
als ob bereits Irrealität auszudrücken gibt es noch weitere sprachliche Mittel, mit denen das möglich ist. Eine Möglichkeit besteht in dem von Ihnen verwendeten
den Anschein erwecken, dass. Dies verwenden Sie im folgenden Beispielsatz:
Beispiel
4) Und so sehr sie auch versuchte, den Anschein zu erwecken, dass sie eine gute Studentin war, gelang es ihr nicht zu verbergen, dass das eher nicht der Fall war.
In diesem Beispiel ist der Konjunktiv möglich, da es gerade darum geht,
Irrealität auszudrücken. Die beschriebene Person ist faktisch keine gute Studentin, sondern suggeriert dies bloß. Diese Bedeutung kann durch die Wahl des Konjunktivs unterstützt werden. Im Regelfall wird dazu der
Konjunktiv II verwendet, wobei auch der
Konjunktiv I zum Ausdruck irrealer Vergleiche verwendet werden kann. (Vgl. Duden 9, S. 594) Allerdings lässt sich auch dafür argumentieren, dass durch die Phrase
den Anschein erwecken, dass die Irrealität bereits hinreichend ausgedrückt wurde, sodass auch der Indikativ denkbar ist:
Beispiel
4a) Und so sehr sie auch versuchte, den Anschein zu erwecken, dass sie eine gute Studentin wäre, gelang es ihr nicht zu verbergen, dass das eher nicht der Fall war.
4b) Und so sehr sie auch versuchte, den Anschein zu erwecken, dass sie eine gute Studentin sei, gelang es ihr nicht zu verbergen, dass das eher nicht der Fall war.
4c) Und so sehr sie auch versuchte, den Anschein zu erwecken, dass sie eine gute Studentin war, gelang es ihr nicht zu verbergen, dass das eher nicht der Fall war.
3. Konjunktiv und Potentialität
Der Konjunktiv kann, wie bereits einleitend erwähnt, dafür genutzt werden, um
Potentialität auszudrücken. Dies geschieht im folgenden Beispielsatz von Ihnen:
Beispiel
5) Sie würde warten, bis er stehen blieb und es ihm auffiel, dass er die Tasche vergessen hatte. Erst wenn er nach ihr rief, würde sie reagieren.
In diesem Beispiel wird würde-Konjunktiv verwendet, um auszudrücken, dass etwas noch nicht eingetreten ist, was aber die Möglichkeit hat einzutreten. Es wird also die Potentialität ausgedrückt. Dafür wird in der Regel der
Konjunktiv II verwendet, da dieser aber identisch mit dem Indikativ in Ihrem Beispiel ist (
sie wartete), ist hier die
Verwendung des würde-Konjunktivs notwendig.
Da hier im Hauptsatz die Potentialität bereits deutlich gemacht wird, kann im Nebensatz auf diesen verzichtet werden, muss aber nicht. Es kann also lauten:
Beispiel
5a) Sie würde warten, bis er stehen blieb und es ihm auffiel, dass er die Tasche vergessen hatte. Erst wenn er nach ihr riefe, würde sie reagieren.
5b) Sie würde warten, bis er stehen bliebe und es ihm auffiele, dass er die Tasche vergessen hatte. Erst wenn er nach ihr riefe, würde sie reagieren.
Beim zweiten Satz handelt es sich wieder um einen Konditionalsatz. Bei diesem sollte auf den würde-Konjunktiv zurückgegriffen werden, um die Irrealität auszudrücken. Würde hier der Konjunktiv II verwendet werden, dann ließe sich die Verbform nicht von der Indikativform unterscheiden, weswegen der würde-Konjunktiv zu wählen ist (
reagierte).
Der Indikativ ist an dieser Stelle nicht möglich, da durch ihn die Irrealität in diesem Beispiel nicht ausgedrückt werden kann und der Satz so seine Bedeutung verändert.
Ein weiterer Beispielsatz, in dem Potentialität ausgedrückt werden soll, ist der folgende:
Beispiel
6) Die Tüte konnte möglicherweise Brausepulver enthalten, aus dem eine tolle Limo wurde, wenn man es in Wasser schüttete.
Auch in diesem Beispiel geht es also um die Beschreibung einer Möglichkeit, wie durch das Wort
möglicherweise bereits deutlich gemacht wird. Deswegen empfiehlt sich die Wahl des Konjunktivs II:
Beispiel
6a) Die Tüte könnte möglicherweise Brausepulver enthalten, aus dem eine tolle Limo würde, wenn man es in Wasser schüttete.
In Ihrem Beispielsatz haben Sie sich ggf. für die Wahl des Indikativs im ersten Teilsatz entschieden, da
durch das Wort möglicherweise hinreichend deutlich wird, dass hier Potentialität artikuliert wird. Zwar scheint der Konjunktiv dies zu unterstützen, ist aber nicht mehr in gleichem Maße notwendig, wie wenn das Modalwort fehlen würde. Dies lässt auch die folgende Variante plausibel erscheinen:
Beispiel
6b) Die Tüte konnte möglicherweise Brausepulver enthalten, aus dem eine tolle Limo würde, wenn man es in Wasser schüttete.
Außerdem könnte Ihre Wahl des Indikativs auch vor dem Hintergrund begründet werden, dass es sich bei Ihren Beispielsätzen offenbar um
Auszüge aus literarischen Texten handelt. Wenn diese im
epischen Präteritum verfasst wurden, dann scheint hier auch der Indikativ Präteritum sinnvoll, um Erzählkonstanz zu gewährleisten.
Zudem wäre hier der Indikativ Präsens möglich, wenn eine allgemeingültige Aussage getroffen werden soll. Handelt es sich also hier um eine Art Regel, dann könnte es auch lauten:
Beispiel
6c) Die Tüte kann möglicherweise Brausepulver enthalten, aus dem eine tolle Limo wird, wenn man es in Wasser schüttet.
Die Variante 6c ist allerdings nur dann möglich, wenn der Beispielsatz nicht Teil eines literarischen Textes ist und das Präteritum als Erzähltempus beibehalten werden soll.
In allen Varianten kann hier im Nebensatz der Indikativ stehen, da bereits im Hauptsatz die Potentialität bzw. das Konditionalgefüge artikuliert wurde und dies offenkundig auch für den anschließenden Nebensatz gilt.
4. Konjunktiv und (irreale) Konditionalsätze
Eine weitere Kategorie von Beispielen sind solche mit Konditionalsätzen. Darunter zählt zunächst das folgende Beispiel:
Beispiel
7) Wenn sie bloß nicht schwieg! Denn wenn sie zuließ, dass er ging, dann wäre das das Ende ihrer Ermittlungen.
Im ersten Satz wird hier der Konjunktiv verwendet, um einen
Wunsch zu artikulieren. In diesem Fall sollte der Konjunktiv stehen. Im zweiten Satz handelt es sich um einen
Konditionalsatz, durch den eine Bedingung mit deren möglichen Folge ausgedrückt wird. Dabei kann durch die Verwendung des Konjunktivs betont werden, dass es sich bei dem im Konditionalsatz Genannten nur um etwas Vorgestelltes bzw. Mögliches handelt. In Ihrem Beispiel scheint es zudem um eine Art innerer Monolog zu gehen, bei dem der Sprecher ausschließt, dass er es zulassen kann, ihn gehen zu lassen. Das bedeutet, dass es hier nicht nur um eine mögliche wenn-dann-Relation geht, sondern hier von einer kontrafaktischen Annahme ausgegangen wird.
Um diese sogenannte Irrealität auszudrücken, kann und sollte der Konjunktiv verwendet werden. Bei Konditionalsätzen ist es allerdings möglich, den Konjunktiv nur in einem der vorausgehenden Teilsatz zu verwenden, da durch ihn hinreichend deutlich wird, dass auch die anderen Teilsätze als irreal zu verstehen sind. Vor diesem Hintergrund sind also diese Varianten möglich:
Beispiel
7a) Wenn sie bloß nicht schwieg! Denn wenn sie zuließe, dass er ginge, dann wäre das das Ende ihrer Ermittlungen.
7b) Wenn sie bloß nicht schwieg! Denn wenn sie zuließe, dass er ging, dann wäre das das Ende ihrer Ermittlungen.
7c) Wenn sie bloß nicht schwieg! Denn wenn sie zuließ, dass er ging, dann wäre das das Ende ihrer Ermittlungen.
Auch in Ihrem weiteren Beispiel liegt ein Konditionalsatz vor, der ähnlich wie das vorherige Beispiel funktioniert:
Beispiel
8) Wenn sie jetzt anfing zu lachen, würde er sie garantiert durchfallen lassen.
Um hier die Potentialität auszudrücken, empfiehlt sich die Wahl des Konjunktivs:
Beispiel
8a) Wenn sie jetzt anfinge zu lachen, würde er sie garantiert durchfallen lassen. (mit würde-Konjunktiv)
8b) Wenn sie jetzt anfinge zu lachen, ließe er sich garantiert durchfallen. (mit Konjunktiv II)
Zur Beibehaltung des Erzähltempus ist es in diesem Fall möglich, im ersten Teilsatz den Indikativ zu verwenden:
Beispiel
8c) Wenn sie jetzt anfing zu lachen, würde er sie garantiert durchfallen lassen. (mit würde-Konjunktiv)
8d) Wenn sie jetzt anfing zu lachen, ließe er sich garantiert durchfallen. (mit Konjunktiv II)
Im dann-Satz sollte in diesem Beispiel jedoch immer der Konjunktiv stehen, da allein durch diesen die Potentialität zum Ausdruck kommt.
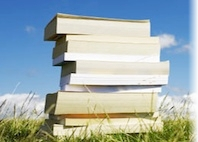





Lesezeichen